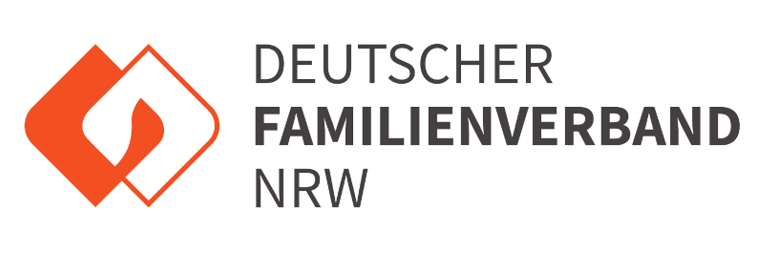
Wir arbeiten derzeit an einer Aktualisierung, um euer Online-Erlebnis zu verbessern.
Unsere Website erhält ein neues Aussehen und spannende Funktionen.
Freut euch mit uns auf eine erfrischte Website, die bald für euch bereitstehen wird.
Vielen Dank für eure Geduld und euer Interesse.
Bitte besucht uns bald wieder!
Für Presseanfragen steht unsere Vorstandsvorsitzende gerne zur Verfügung:
Petra Windeck
Tel. 0172 586 14 43
E-Mail: windeck@dfv-nrw.de
Deutscher Familienverband NRW e.V.
Kalker Haupstr. 220-222 • 51103 Köln
Besucht uns auch auf Instagram
Impressum
Deutscher Familienverband
Landesverband NRW e.V.
Elsbachstraße 107
51379 Leverkusen
Kontakt
Telefon: 02171 – 341270
Fax: 02171 – 341758
E-Mail: info@dfv-nrw.de
Presseanfragen an Frau Petra Windeck
erreichbar unter 0172 – 5861443